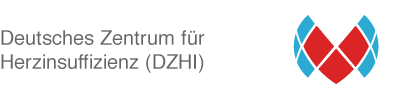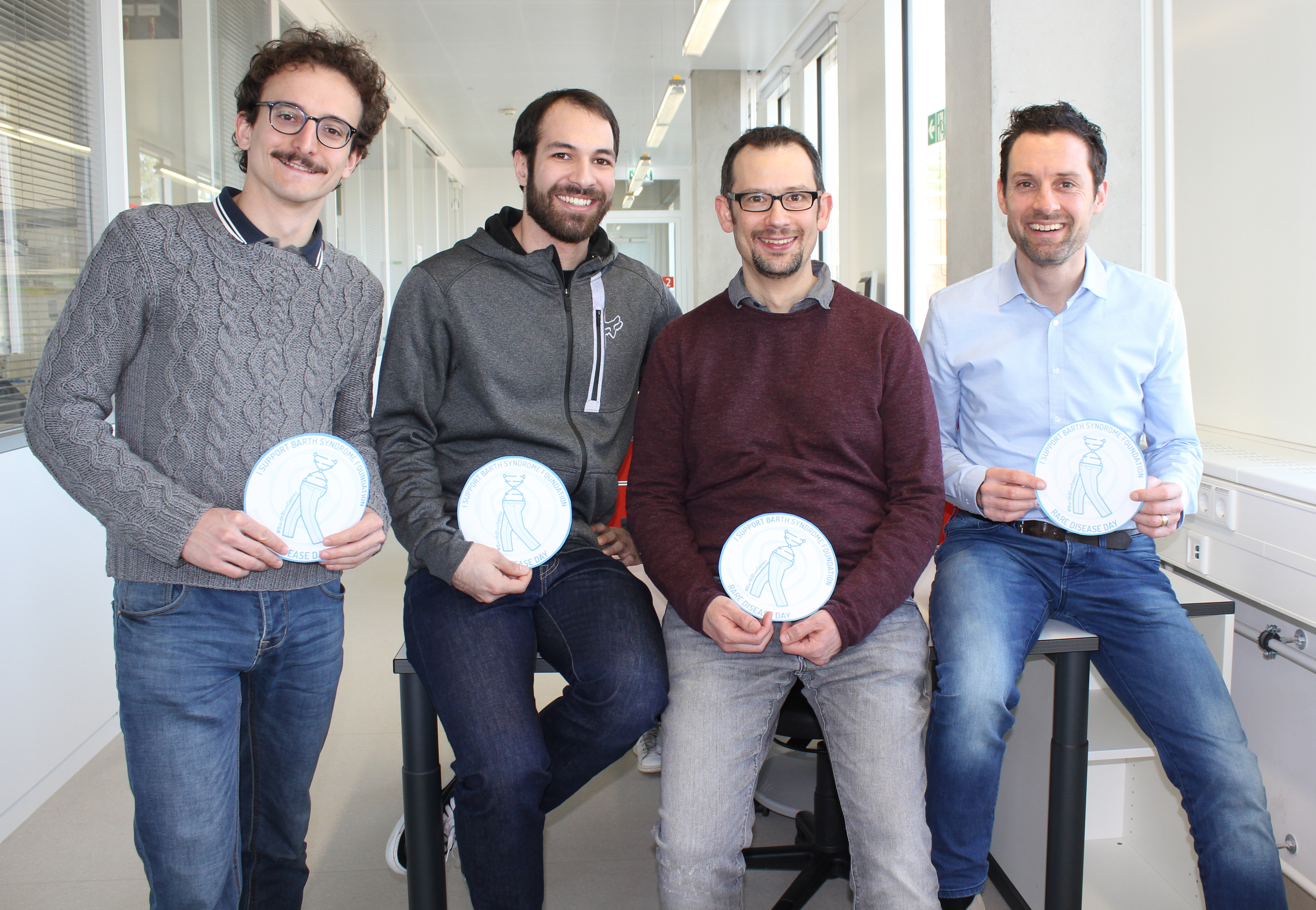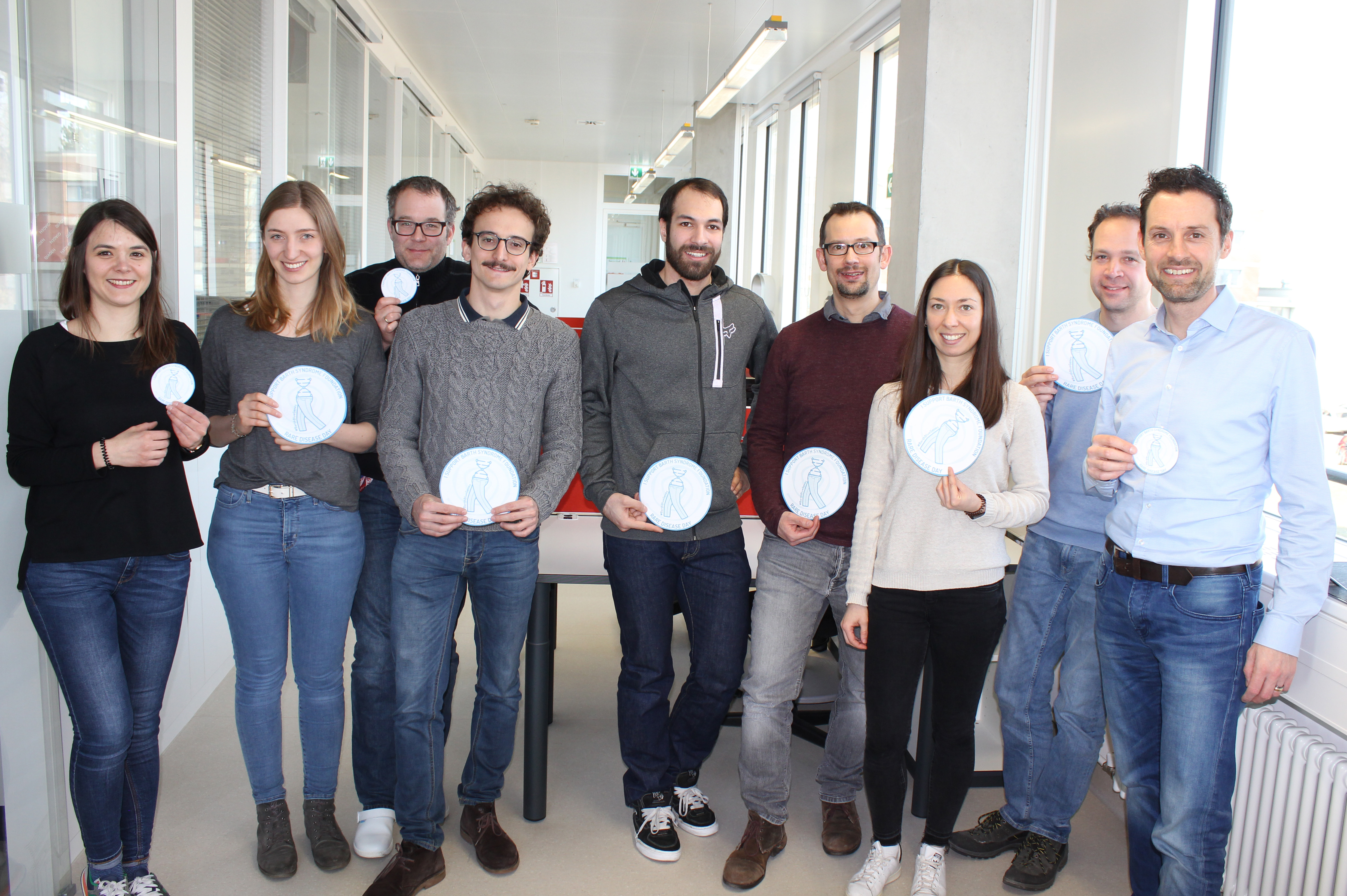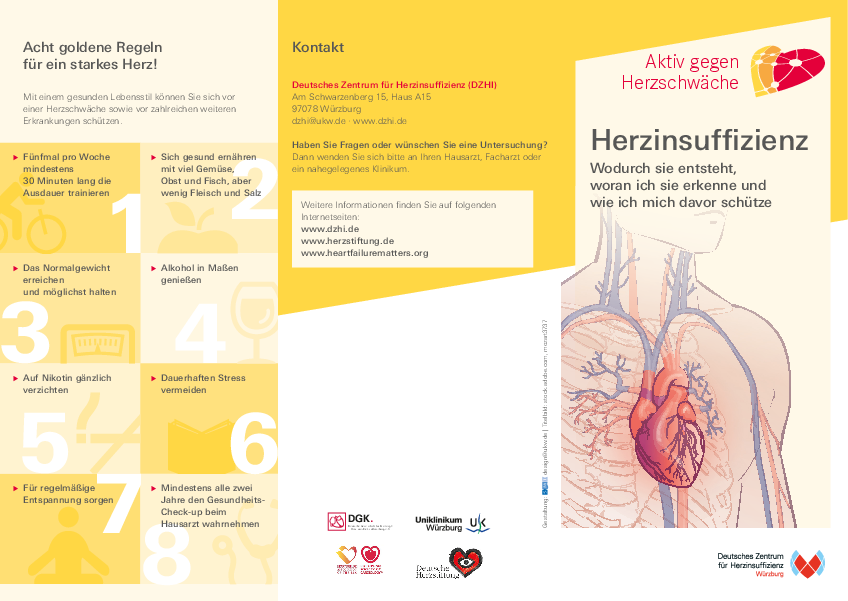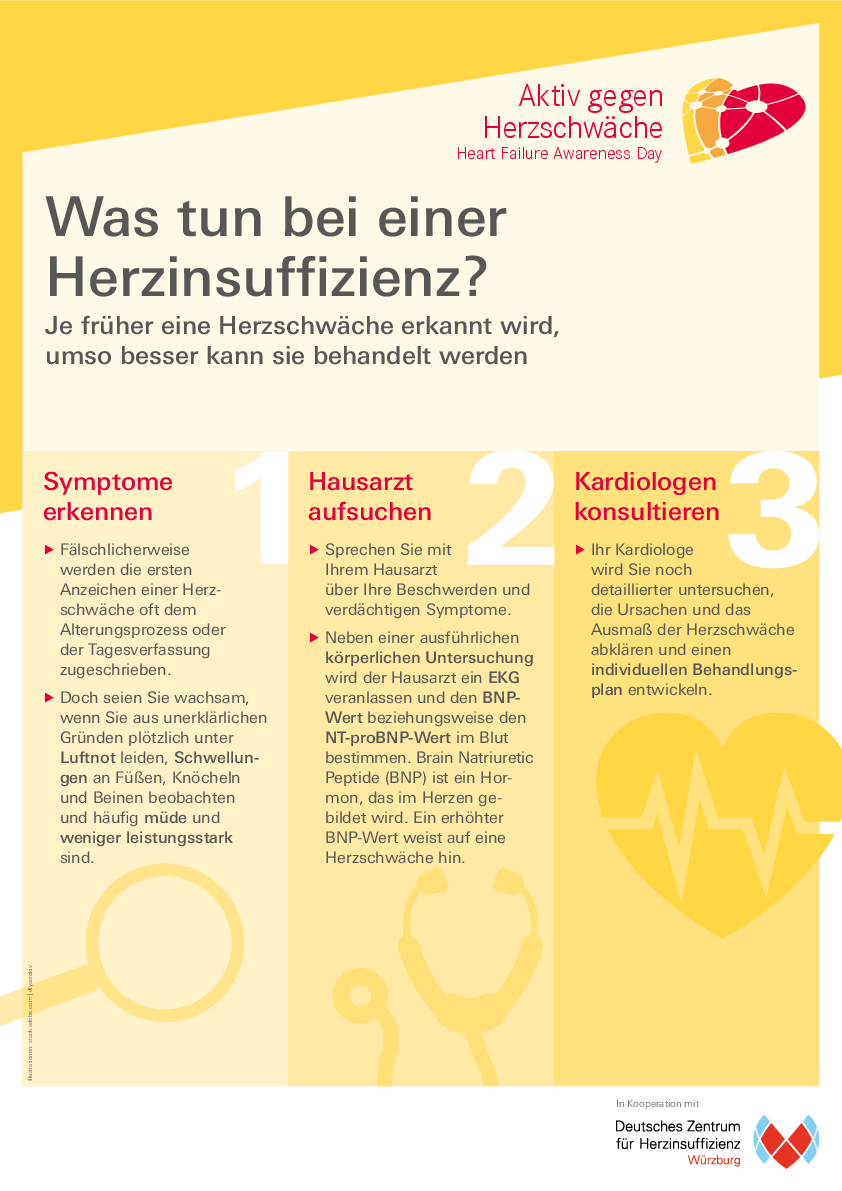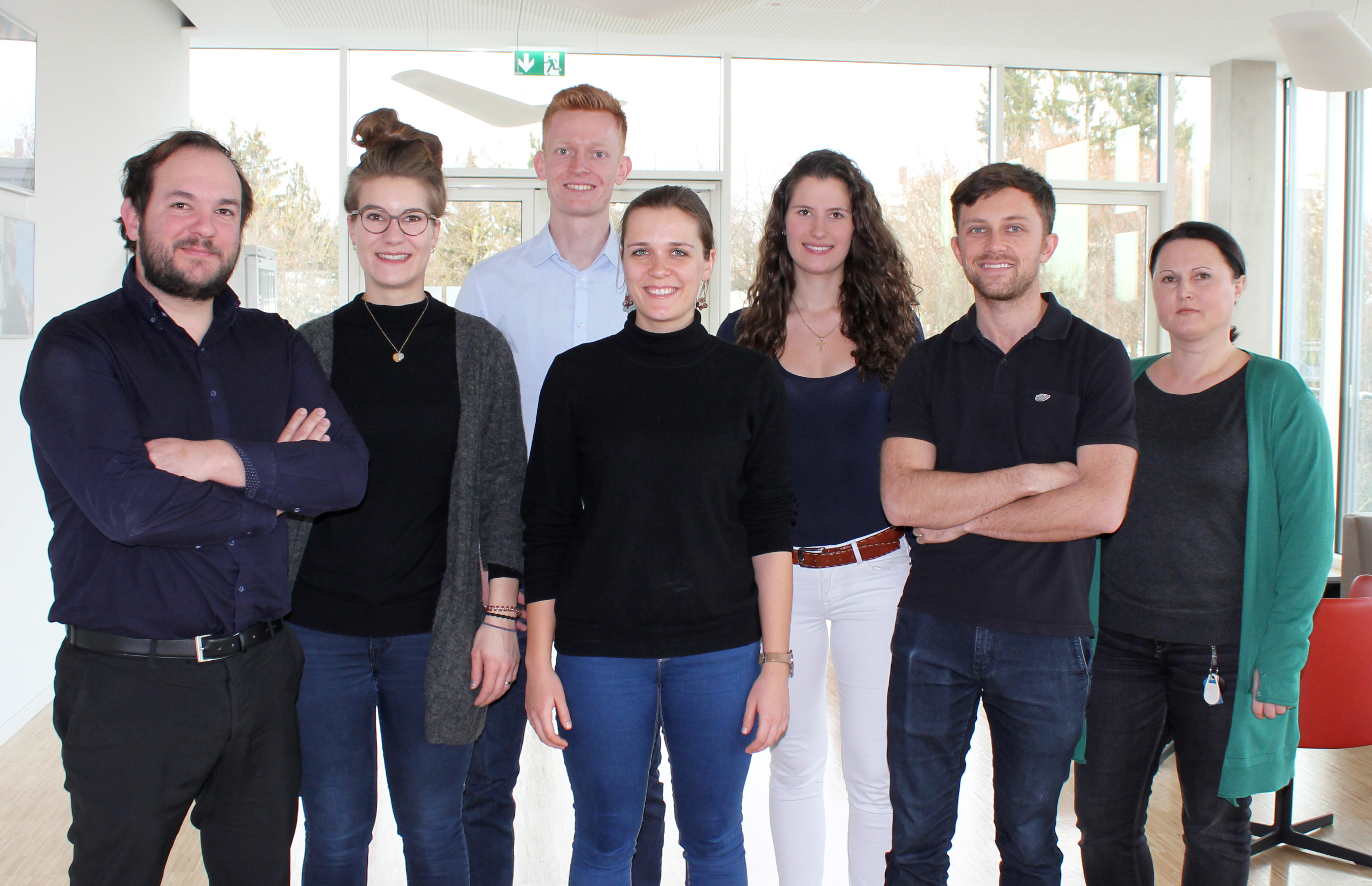
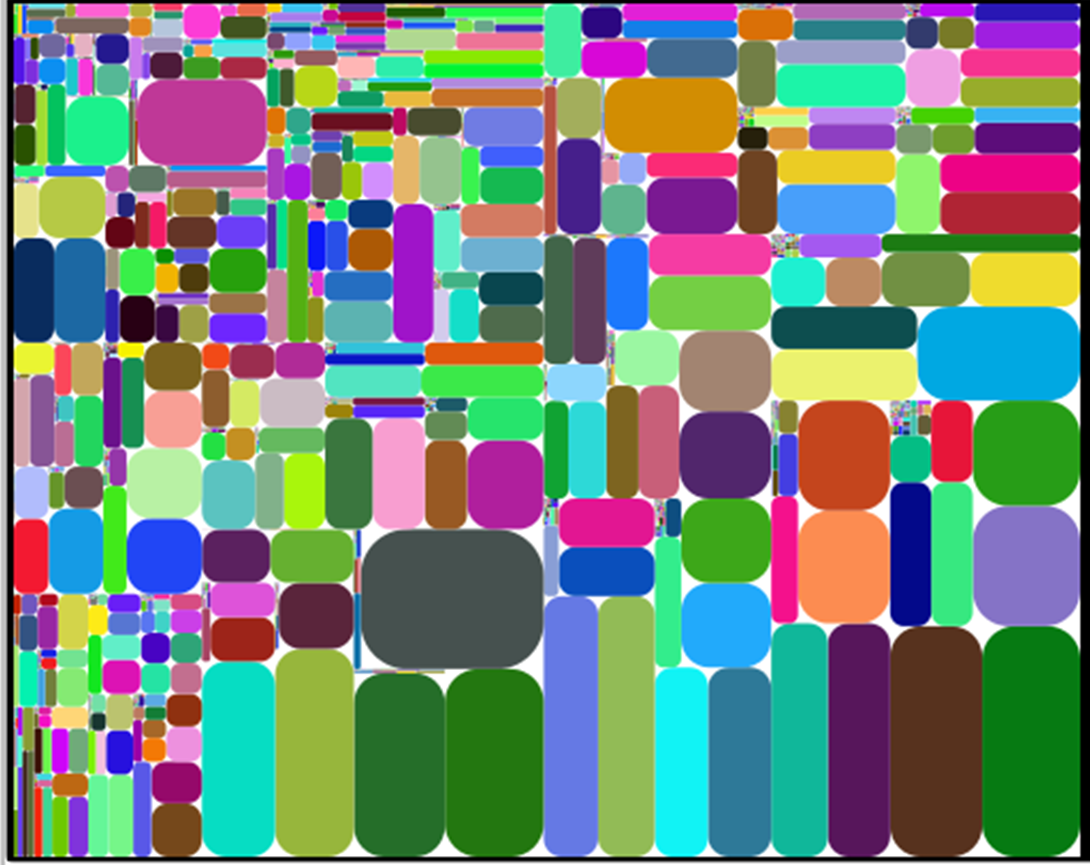
Herz-Kreislaufkrankheiten treten mit zunehmendem Alter immer häufiger auf. Aber nicht nur Herz und Blutgefäße altern, sondern auch das Immunsystem, man spricht dann von einer Immunoseneszenz. „In den bisherigen experimentellen Studien wurde vornehmlich junges und gesundes Biomaterial untersucht, was nicht unbedingt die klinische Situation widerspiegelt“, erläutert Dr. Gustavo Ramos, Biologe am Deutschen Zentrum für Herzinsuffizienz Würzburg (DZHI) am Uniklinikum Würzburg (UKW). In seinem neuen von der DFG geförderten Forschungsprojekt möchte er daher die Rolle von speziellen Immunzellen, den T-Zellen, nach einem Myokardinfarkt im alten Organismus untersuchen. „Wir konnten in den vergangenen Jahren zeigen, dass die T-Zellen als Helferzellen des Immunsystems eine frühe Heilung nach einem Herzinfarkt in jungen Versuchstieren unterstützt“, erklärt Ramos. „Andererseits fördern diese T-Zellen aber auch altersbezogene Umbauvorgänge im Herzen. In unserem DFG-Projekt möchten wir deshalb die Bedeutung der Immunoseneszenz für die Infarktheilung untersuchen.“
Der 37-Jährige hat in Brasilien Biologie studiert und im Fach Pharmakologie promoviert. Immunologische Aspekte standen schon früh im Fokus seiner Forschung. Von der Immunologie in der Evolution im Allgemeinen kam er schließlich zum Herzen im Speziellen und im Jahr 2013 nach Würzburg. Am Uniklinikum Würzburg wird bereits seit mehr als 30 Jahren an entzündlichen Prozessen im Herzen geforscht, und es findet seit langem eine enge Zusammenarbeit der Fachbereiche Immunbiologie und Kardiologie statt.
Einer, der seit den 1990er Jahren an diesem Thema arbeitet und die Arbeit von Gustavo Ramos unterstützt, ist Professor Stefan Frantz, Leiter der Medizinischen Klinik und Poliklinik I am Uniklinikum Würzburg: „Wir wissen seit langem, dass Patienten nach einem Herzinfarkt unterschiedlich gute Heilungsverläufe aufweisen. Nun gilt es herauszufinden, welche Faktoren die Heilungsprozesse wie fördern oder behindern, und wie man diese rechtzeitig erkennen und die Heilung positiv beeinflussen kann.“
Die Förderung des neuen ERA-Forschungsprojekts kommt da gerade recht: „Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit Professor Peter Rainer von der Medizinischen Universität Graz und Professor Encarnita Mariotti-Ferrandiz von der Sorbonne Université Paris nach neuen immunbasierten Prognosewerkzeugen und innovativen Behandlungskonzepten für Herzinfarkt-Patienten suchen können“, kommentiert Gustavo Ramos den Beginn des interdisziplinären Forschungsprojekts und erläutert das Dreigestirn: „In Graz befindet sich neben einer ausgezeichneten Kardiologie mit dem Diagnostik- und Forschungsinstitut für Pathologie eine umfangreiche Biobank. In Paris ist der immunologische Schwerpunkt, hier wurde einst der AIDS-Virus entdeckt. Würzburg fungiert als Schnittstelle von Immunologie und Kardiologie.“
Gemeinsam werden die Wissenschaftler die T-Zellen und ihr ambivalentes Verhalten unter die Lupe nehmen. Dazu sollen mithilfe des genanalytischen Verfahrens Next-Generation-Sequencing spezifische T-Zell-Profile identifiziert werden, die einen prognostischen Nutzen bringen und helfen, die guten von den schlechten „Heilern“ zu unterscheiden. Ziel ist es, einen Biomarker zu entwickeln, mit dem sich die Qualität des Heilungsprozesses erkennen lässt und eine T-Zell-basierte Therapie zu finden, mit der die kardiale Heilung verbessert werden kann.
Pressemitteilung als PDF.
Hier bekommen Sie weitere Informationen zur Juniorforschungsgruppe von Gustavo Ramos.