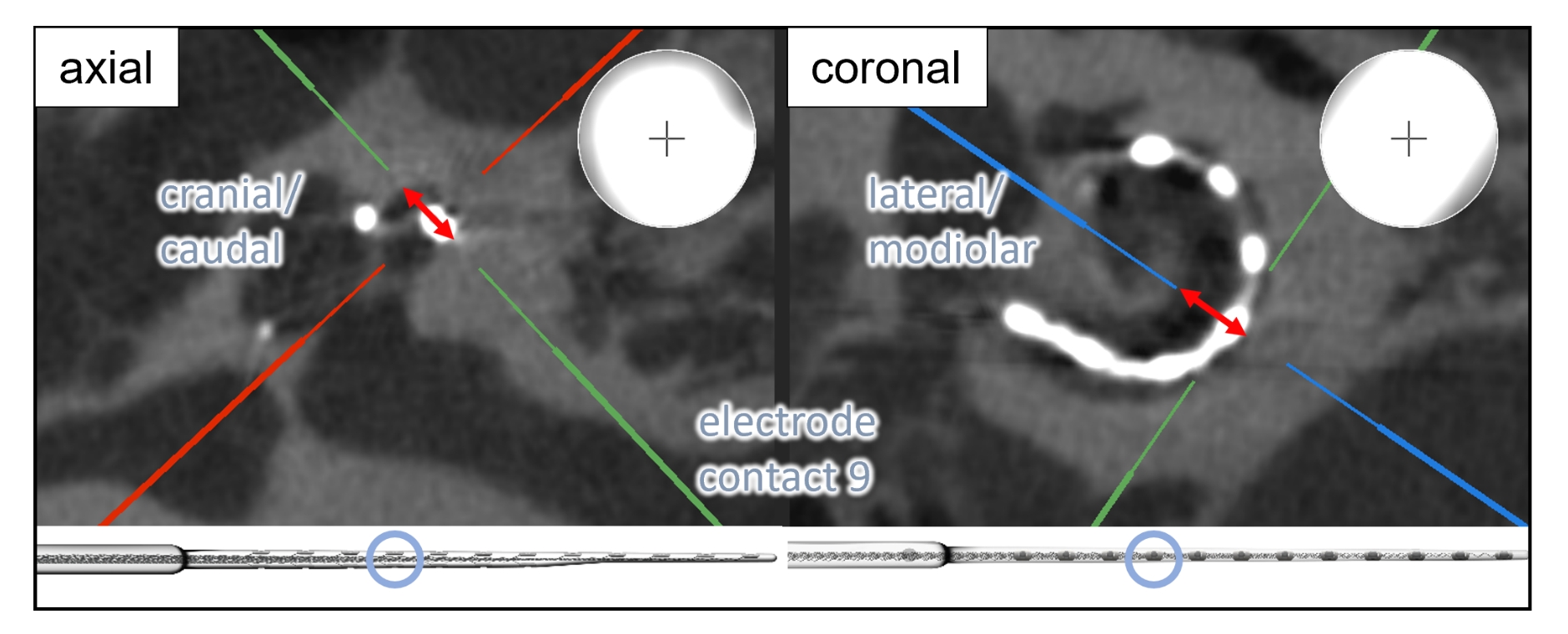Die Arbeitsgruppe „Virtual Reality Simulation im Medizinstudium“ hat unter der Leitung von Tobias Mühling gemeinsam mit dem Münchner 3D-Visualisierungsunternehmen ThreeDee das VR-basierte Trainingsprogramm STEP-VR (Simulation-based Training of Emergencies for Physicians using Virtual Reality) entwickelt. In einer Studie wurden nun die kurz- und langfristigen Lerneffekte des VR-basierten Notfalltrainings untersucht. Die im renommierten Journal of Medical Internet Research veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass direkt nach dem Training die VR-Gruppe und die Kontrollgruppe beim Wissenstest ähnlich gut abschnitten. Nach 30 Tagen zeigte sich jedoch ein klarer Vorteil für die VR-Gruppe: Ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich deutlich mehr Wissen merken. Insgesamt bewerteten die Studierenden das VR-Training auch als wirkungsvoller, spannender und hilfreicher.
Marco Lindner, Tobias Leutritz, Joy Backhaus, Sarah König, Tobias Mühling. Knowledge Gain and the Impact of Stress in a Fully Immersive Virtual Reality–Based Medical Emergencies Training With Automated Feedback: Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res 2025;27:e67412, doi: 10.2196/67412, PMID: 40465566